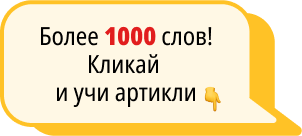Задания Д39 C1 № 1629
Ihre deutsche Brieffreundin Leonie aus Göttingen schreibt über ihre Freundinnen:
… Ich habe vor Kurzem ein Buch über den Moskauer Kreml auf Deutsch gekauft. Ich will nun nächsten Winter Moskau besuchen und habe schon eine Reise gebucht. Mein Hotel liegt aber weit von der Stadmitte entfernt. Wie kann ich in den Kreml kommen? Was für Kleidung soll ich mitnehmen, um auf den Winter in Moskau bestens vorbereitet zu sein? Was sollte ich noch unbedingt in Moskau sehen?
In diesem Sommer möchte ich nach einem Ferienjob suchen …
Nun möchten Sie Leonie über ihre Freunde / Freundinnen erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:
• Fragen von Leonie beantworten;
• 3 Fragen zu Leonies Besuch der Oper formulieren.
Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten.
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.
Спрятать пояснение
Пояснение.
St. Petersburg, Russland
Den 30. November
Liebe Leonie,
vielen Dank für deinen Brief. Ich freue mich sehr, dass du geschrieben hast. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich habe mich auf einen Wettbewerb vorbereitet.
Es ist toll, dass du nach Moskau fahren willst. Ich war schon einmal im Moskauer Kreml, es ist wunderbar. Ich meine, dass das kein Problem ist, dass dein Hotel weit von der Stadmitte entfernt liegt. Du musst nicht nur das Zentrum besichtigen. Vom Hotel zum Zentrum kannst du mit der U-Bahn fahren. Nimm unbedingt warme Kleidung mit, weil es ziemlich kalt in Moskau im Winter ist.
Übrigens, du hast von dem Ferienjob erwähnt. Hast du früher schon gearbeitet? Als was möchtest du arbeiten? Ist das nicht schwer, in den Ferien zu arbeiten?
So, nun muss ich aber Schluss machen, weil ich und mein Bruder ins Schwimmbad gehen.
Schreibe bald.
Viele Grüße
Sascha
Спрятать критерии
Критерии проверки:
| Критерий | Критерии оценивания ответа на задание С1 | Баллы |
|---|---|---|
| K1 | Решение коммуникативной задачи | |
| Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании (даны полные ответы на все вопросы, заданы три вопроса по указанной теме); стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости |
2 | |
| Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в задании (более одного аспекта раскрыто не полностью, или один аспект полностью отсутствует); встречаются нарушения стилевого оформления речи или/и принятых в языке норм вежливости |
1 | |
| Задание не выполнено: содержание не отражает тех аспектов, которые указаны в задании, или/и не соответствует требемому объёму |
0 | |
| K2 | Организация текста | |
| Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст верно разделён на абзацы; структурное оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка | 2 | |
| Высказывание не всегда логично; имеются недостатки/ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы нелогично/отсутствует; имеются отдельные нарушения принятых норм оформления личного письма | 1 | |
| Отсутствует логика в построении высказывания; принятые нормы оформления личного письма не соблюдаются | 0 | |
| K3 | Языковое оформление текста | |
| Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче; орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2 негрубых лексико-грамматических ошибок или/и не более 2 негрубых орфографических и пунктуационных ошибок) | 2 | |
| Имеются лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие понимания текста; имеются орфографические и пунктуационные ошибки, не затрудняющие коммуникации (допускается не более 4 негрубых лексикограмматических ошибок или/и не более 4 негрубых орфографических и пунктуационных ошибок) | 1 | |
| Понимание текста затруднено из-за множества лексико-грамматических ошибок | 0 | |
| Максимальное количество баллов | 6 |
Источник: ЕГЭ по немецкому язык 2017. Досрочная волна
Ist er ein Partykiller, Miesepeter, Apokalyptiker? Weniger zu verbrauchen, kann den Genuss steigern, sagt der Ökonom. Er hält Kapitalismus für eine „Zombiekategorie“.
„Es kann den Genuss steigern, weniger zu konsumieren. Man hat mehr Zeit für die Tätigkeiten, die einem wirklich wichtig sind.“ Bild: dpa
taz: Herr Paech, was wirft man Ihnen am häufigsten vor?
Niko Paech: Dass ich ein Miesepeter sei, ein Partykiller, der die moderne Freiheit und Selbstverwirklichung einschränken wolle. Manche meinen gar, ich sei ein Apokalyptiker.
Und was sagen Sie dann?
Dass ich ein Optimist bin.
Sie prognostizieren den Untergang des Kapitalismus. Was ist daran erfreulich?
„Kapitalismus“ ist eine Zombiekategorie. Fragen Sie fünf Kapitalismuskritiker, was der Kapitalismus ist, dann bekommen Sie sechs Antworten.
Aber wie immer man den Kapitalismus definiert – Sie sehen seinem Ende gelassen entgegen. Wieso?
Das Wirtschaftswachstum gerät an seine Grenzen. Rohstoffe und Umwelt werden knapp. Wir erleben nicht nur „Peak Oil“, sondern „Peak Everything“. Aber das ist keine Katastrophe. Die prosperierende Mittelschicht erstickt längst an ihrem immensen Wohlstand und kann nicht mal mehr ihre digitale Coolness glückstiftend verarbeiten. Konsum macht keine Freude, sondern strengt an. Das knappste Gut ist unsere Lebenszeit – die wir damit verschwenden, Waren herzustellen und zu kaufen, die wir nicht benötigen.
53, ist außerplanmäßiger Professor für Produktion und Umwelt in Oldenburg. Er gehört zu den bekanntesten Wachstumskritikern in Deutschland. Von ihm stammt das Buch: „Befreiung vom Überfluss“ (Oekom 2012).
Sie besitzen keinen Föhn, keine Mikrowelle, kein Auto und kaum neue Kleidung. Das alles habe ich auch nicht. Trotzdem glaube ich nicht, dass Konsumverzicht die Lösung ist.
„Verzicht“ ist das falsche Wort, weil es eine leidvolle Entsagung nahelegt. Dabei kann es den Genuss steigern, weniger zu konsumieren. Man hat mehr Zeit für die Tätigkeiten, die einem wirklich wichtig sind.
Stimmt: Konsum kann nerven. Aber wenn alle ihren Konsum einschränken, bricht der Kapitalismus zusammen – und zwar chaotisch. Die Finanzkrise hat gezeigt, dass unser Wirtschaftssystem selbst kleine Einbrüche nicht verkraftet. Schon ein Minuswachstum von 5 Prozent hat 2009 Panik ausgelöst.
Welche Panik? Haben Sie etwas vom Einbruch 2009 gemerkt? Es wurden weiter Einfamilienhäuser gebaut und wurde weiter SUV gefahren. Wir haben die Komfortzone nicht verlassen. Nur die Medien haben es als eine Krise interpretiert.
Die Konjunktur konnte nur stabilisiert werden, weil der Staat Milliarden Euro in die Wirtschaft gepumpt hat. Ohne diese Intervention wären Millionen Menschen arbeitslos geworden.
Das halte ich für übertrieben und blind gegenüber der Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verkürzen und umzuverteilen. Okay, dann verlieren einige. Aber ich habe nie behauptet, dass es eine bessere Welt zum Nulltarif gibt. Im Übrigen haben wir absehbar sowieso keine Wahl. Das jetzige Wirtschaftssystem ist ökonomisch und ökologisch nicht zu stabilisieren.
Sie wollen 50 Prozent aller Straßen schließen und 75 Prozent der Flughäfen abschaffen. Ganz konkret: VW hat etwa 260.000 Beschäftigte in Deutschland. Wovon sollen die künftig leben?
Selbst als radikaler Wachstumskritiker kann ich nicht einfach einen Konzern wie VW stilllegen; die sozialen Härten wären nicht aushaltbar. Doch ist der langsame Abschied von industrieller Bequemlichkeit unvermeidbar. Dieser Rückbau muss geordnet stattfinden – durch Arbeitszeitverkürzung. Wenn jeder Mensch nur noch 20 Stunden pro Woche arbeitet, bleibt genug Zeit, um ergänzende Formen der Selbstversorgung zu praktizieren, etwa Nahrung selbst anzubauen, Güter gemeinschaftlich zu nutzen oder Dinge zu reparieren.
Sie gehen davon aus, dass eine Wirtschaft geordnet schrumpfen kann. Doch das funktioniert nicht. Sobald die Gewinne sinken, investiert niemand mehr – und die Wirtschaft befindet sich im freien Fall.
Der tiefe Fall droht, wenn wir nicht vorbereitet sind. Deshalb benötigen wir Übungsprogramme und Rettungsinseln, auf denen trainiert wird, mit einem solchen Rückbau zurechtzukommen. Beispiele gibt es bereits: Urban Gardening, die Regio-Geld-Bewegung oder Repair-Cafés. Eine Avantgarde könnte vorführen, wie man mit weniger Geld, Markt, Banken, ohne Renditewirtschaft und mit weniger Wohlfahrtsstaat leben kann.
Ein unfreiwilliges Modell dieser Art existiert bereits: Griechenland. Arbeitslose Athener gehen zurück in das Dorf ihrer Großeltern und bestellen dort mit Hacke und Esel Miniparzellen.
Was in Griechenland passiert, ist schlimm, eben weil es unfreiwillig und unvorbereitet eintrat. Was aber, wenn die Griechen in zehn Jahren selbstbewusst sagen können: Wir sind die Avantgarde, weil wir gemeistert haben, was andere noch vor sich haben?
Griechenland ist jetzt so arm, dass viele Krebskranke nicht mehr richtig behandelt werden. Soll das die Zukunft sein?
Hier verwechseln Sie ein Verteilungs- mit einem Wachstumsproblem. Ein hinreichend geordneter Übergang zur Postwachstumsökonomie könnte die Gesundheitsversorgung sogar verbessern.
Aber wie? Ihr Modell wirkt unausgewogen: Die kapitalistische Privatwirtschaft soll weitgehend verschwinden, aber der Staat soll seine Aufgaben weiter wahrnehmen. Er soll nicht nur Krebstherapien gewährleisten, sondern auch Renten zahlen. Es soll Bildung, Forschung, Bahnen und Busse geben. Wie soll das finanziert werden, wenn die Steuereinnahmen wegbrechen?
Viele Subventionen für Verkehr, Landwirtschaft und Industrie würden wegfallen. Manche Gesundheitsausgaben könnten sinken, wenn wir mehr Bewegung, weniger Stress und bessere Ernährungsgewohnheiten hätten. Unsere planwirtschaftliche Bildungspolitik ist ebenfalls überkandidelt. 50 Prozent der jungen Menschen sollen zu Akademikern ausgebildet werden. Aber an wen delegieren wir dann die physische Arbeit, die steigender Konsum voraussetzt?
Sie selbst haben von der Bildungsexpansion in den 1970er Jahren profitiert. Diese Chance wollen Sie anderen verweigern?
Dann vergleichen Sie mal den Ressourcenaufwand des damaligen Bildungssystems mit dem heutigen: Wie viel an Flugreisen, digitaler Kommunikation, räumlicher oder technischer Ausstattung war damals erforderlich?
Ihr Vorschlag wirkt altbekannt. Bereits vor dreißig Jahren gab es viele Aussteiger, die auf Konsum verzichteten. Die Grünen sind durch diese Alternativbewegung entstanden – mussten aber erkennen, dass es gar nicht einfach ist, den Kapitalismus abzuschaffen.
Die frühere Aussteigerbewegung war romantisch, wollte raus aufs Land. Mein Ansatz ist genau umgekehrt: Ich rede nicht von Stadtflucht, sondern von urbaner Subsistenz. Je mehr nichtindustrielle Versorgungsformen wir wollen, desto mehr soziale Vernetzung benötigen wir, die in hochverdichteten Metropolen eher zu finden ist.
Sie begeistern Ihre Zuhörer und füllen viele Vortragssäle – aber die Parteien übernehmen Ihre Vorschläge nicht. Wie erklären Sie diesen Widerspruch?
Auch einige hundert Leute, vor denen ein Wachstumskritiker wie ich zuweilen redet, bleiben Teil einer Minderheit. Was die Parteien angeht: Die haben vor nichts mehr Angst, als konsumabhängige Wähler zu überfordern.
.
Text:
Konsum macht uns nicht glücklich und nachhaltiges Wachstum ist eine Lüge, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech.
Wenn es nach Niko Paech ginge, würden Auslandsreisen verboten. (Foto: Lili May)
Ich dachte, Konsum macht uns glücklich und ist gut für die Wirtschaft. In Ihrem Buch „Befreiung vom Überfluss» wirkt das gar nicht mehr so positiv.
Niko Paech: Konsum bedeutet immer eine Belastung für die Umwelt. Man eignet sich Dinge an, die man nicht selbst produziert hat. Diese Produkte haben einen Weg hinter sich, der nicht ökologisch neutral sein kann. Mir geht’s nicht darum, Konsum zu verbieten, sondern durch eine Obergrenze zu regulieren.
Außerdem wirkt in Ihren Beschreibungen unser System sehr instabil.
Ja, ich glaube, dass die Stabilität unseres Systems nicht zu wahren ist. Immerhin gibt es gleich mehrere Krisenherde: Zunächst ist die Finanzkrise zu nennen. Aus den bisherigen Verfehlungen des Finanzsystems haben wir nichts gelernt. Ein weiteres Problem ist die Verknappung der Ressourcen wie Rohöl, Flächen oder seltener Erden. Als drittes Problem sehe ich eine psychologische Krise. Unsere Gesellschaft und Ihre unbegrenzten Möglichkeiten überfordern und stressen uns zunehmend. Als vierter Faktor kommt eine ökologische Krise dazu, die sich in den nächsten Jahren verschärfen wird.
Malen Sie nicht etwas zu schwarz? Wir Deutschen tun doch eigentlich viel für den Klimaschutz.
Dass wir Deutschen auf einem guten Weg in Sachen Klimaschutz sind, ist großer Quatsch. Erstens verlagern wir das Problem in die Natur und Landschaften. Zweitens werden gigantische Kohlekraftwerke gebaut. Drittens umfasst die „Energiewende» nur Elektrizität. Aber wo bleiben der Flug- und Autoverkehr, die Heizenergie und die Energie, die in die importierten Güter einfließt? Viertens — und das ist das größte Problem — ist von Einsparung nirgends die Rede.
Ich habe die Energiewende bisher für sinnvoll gehalten.
Stimmt im Prinzip auch. Aber als erstes muss massiv Energie einspart werden und dann kann der Restbedarf mittels erneuerbarer Energien befriedigt werden. Zum Atomausstieg gibt es natürlich keine Alternative. Aber gerade bebauen wir nur unsere letzten Naturflächen mit Windräder und Solaranlagen.
Sie kritisieren auch unser Reiseverhalten.
Unsere heutige Art zu Reisen ist langfristig kaum möglich. Auf legale Weise kann man der Umwelt kaum mehr schaden, als mit einer Flugreise. Echter Klimaschutz kann nur bedeuten, dass jeder Mensch nur noch eine bestimmte Menge an CO2 freisetzen darf, nämlich zwei bis drei Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: Eine Flugreise in die USA liegt bei vier und nach Australien bei über 14 Tonnen.
Ich wollte aber immer viel von der Welt sehen und habe die Globalisierung als ein Segen empfunden. Liege ich damit falsch?
Globalisierung ist sogar der Gipfel der Verantwortungslosigkeit, durch die Entgrenzung der Welt entsteht auch eine Entgrenzung unserer Bedürfnisse. Ohne Globalisierung hätten wir nur die Hälfte unseres Wohlstandes, aber auch viele unserer Probleme nicht. Weder das iPad noch das Hemd werden noch in Deutschland produziert. Oder nehmen wir Schuhe — pro Jahr werden viele Milliarden davon produziert, und zwar weil sie in Asien so billig sind. Würden wir in Deutschland produzieren, wären die Schuhe teurer und wir müssten deutlich sorgfältiger damit umgehen.
Ok, was müssen wir denn jetzt aus Ihrer Sicht ändern?
Der erste Schritt wäre mehr eigene Produktion, zum Beispiel in Gemeinschaftsgärten. Der zweite Schritt ist der pflegliche Umgang mit Gegenständen, wir müssen zu einer Reparaturgesellschaft werden. Wenn wir die Nutzungsdauer unserer Produkte verdoppeln, halbieren wir auch den Bedarf. Der dritte Punkt ist die Organisation von Gemeinschaften. Man kann sich auch zu viert ein Auto oder die Bohrmaschine teilen. Das sind keine revolutionären Veränderungen, sondern vielmehr Dinge, die unsere Eltern und Großeltern schon umgesetzt haben und deren Nützlichkeit nur vergessen wurde. Deshalb bedeutet Ihre Umsetzung keineswegs ein Leben im Büßerhemd.
Über welche Zeiträume des Scheiterns sprechen wir eigentlich? Ist das noch mein Problem oder eher das meiner Kinder?
Ich denke eher an kurze Zeitabschnitte, also 10 bis 15 Jahre. Eine Preissteigerung unserer Alltagsgegenstände und das Sinken unserer Kaufkraft werden wir definitiv bald erleben, einfach weil bestimmte Ressourcen wie etwa Öl teurer werden. Auch für das Erreichen realistischer Klimaschutzziele haben wir vielleicht noch eine Dekade Zeit, wenn wir bis dahin unsere CO2 Emission nicht drastisch gesenkt haben, hat es sich praktisch auch erledigt.
Zu Niko Paech
Niko Paech ist einer der bedeutendsten deutschen Wachstumskritiker — und er ist authentisch, denn er lebt seine Vision einer «entschleunigten und entrümpelten Welt». Der Volkswirtschaftler ist seit 2010 Gastprofessor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Universität Oldenburg. Als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Attac genießt er einen hohen Bekanntheitsgrund und findet bei einer breiten Öffentlichkeit Gehör.
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для
проведения в 2011 году единого государственного экзамена по немецкому
языку
Раздел 1. Аудирование (тексты для аудирования представлены ниже)
B1 Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие
между высказываниями каждого говорящего 1–6 и утверждениями, данными в
списке A–G. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей
буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы
услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
A. Ohne Fleiß kann man sein Ziel nicht erreichen.
B. Ich bin für alte Musik ganz begeistert.
C. Musik darf man nicht gefühllos unterrichten.
D. Mit Ungeduld warte ich auf meinen ersten Musikunterricht.
E. Lieder von meinen liebsten Gruppen kenne ich auswendig.
F. Die klassische Musik kann man nur im Konservatorium genießen.
G. Obwohl ich keine Singstimme habe, singe ich ständig.
Вы услышите разговор друзей. Определите, какие из приведенных
утверждений А1–А7 соответствуют содержанию текста (1 – Richtig), какие
не соответствуют (2 –Falsch) и о чем в тексте не сказано, то есть на
основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа
(3 – Nicht im Text). Обведите номер выбранного вами варианта ответа. Вы
услышите запись дважды.
A1 Michael macht eine Reise durch Frankreich.
1) Richtig 2) Falsch 3) Nicht im Text
A2 Michael kommt ins Büro später als seine Kollegen.
1) Richtig 2) Falsch 3) Nicht im Text
A3 Eine der Aufgaben von Karolin ist Kundendaten in den Computer einzugeben.
1) Richtig 2) Falsch 3) Nicht im Text
A4 Karolins Kollegen sind an mehr deutschen Praktikanten interessiert.
1) Richtig 2) Falsch 3) Nicht im Text
A5 Dank einem Sprachkurs hat Michael seine Sprachkenntnisse verbessert.
1) Richtig 2) Falsch 3) Nicht im Text
A6 Die Atmosphäre in Karolins Firma ist sehr angenehm.
1) Richtig 2) Falsch 3) Nicht im Text
A7 Die Kollegen geben Michael zu verstehen, dass er keine Angst haben soll zu fragen.
1) Richtig 2) Falsch 3) Nicht im Text Вы услышите интервью. В заданиях
А8–А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами
варианту ответа. Вы услышите запись дважды.
A8 «Peace Wall» ist eine Wand, die…
1) mit Kultur eines Landes bekannt macht.
2) eine Friedensbotschaft vermittelt.
3) örtliche Politik verständlich macht.
A9 Als Vogel den Irak besuchte, …
1) warnte man ihn vor der Reise.
2) fuhr er mit dem Auto über die Grenze.
3) wurde er von Amtleuten verfolgt.
A10 Als Vogel im Irak arbeitete, …
1) waren die Iraker von seinem Mut beeindruckt.
2) war seine Malerei nur Kindern interessant.
3) beleuchteten die Medien seine Arbeit.
A11 In Kingston hat es Vogel besonders beeindruckt, …
1) dass die Kinder auf Hausbooten wohnen.
2) wie sich das Leben in armen Vierteln abspielt.
3) dass er einem Treffen mit Rebellenführern persönlich beiwohnen konnte.
A12 Es kam auch während Vogels Reisen dazu, dass…
1) er sich mehrmals Gefahr ausgesetzt hat.
2) er sich am Aufstand beteiligte.
3) er illegal eine Grenze passierte.
A13 Das Projekt wird größtenteils dadurch finanziert, dass …
1) regionale Künstlerorganisationen Vogels Aufenthalt bezahlen.
2) private Personen Geld für seine Reisen geben.
3) Vogel sein eigenes Geld dafür aufbringen muss.
A14 Vogel setzt seine Arbeit fort, obwohl …
1) er von manchen auch gescholten wird.
2) seine Anstrengungen nutzlos sind.
3) das Projekt viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt. По окончании выполнения заданий В1 и
А1–А14 НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ СВОИ ОТВЕТЫ В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ, что ответы на задания В1, А1–А14 располагаются в разных частях
бланка. В1 расположено в нижней части бланка. При переносе ответов в
задании В1 буквы записываются без пробелов и знаков препинания.
Раздел 2. Чтение
B2 Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G.
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один заголовок лишний.
1. Funktionell und technisch perfekt
2. Der Beruf des Modedesigners
3. Mehr als «Vorsprung durch Technik»
4. Bedeutung von Modedesign
5. Design-Ausbildungsstätten in Deutschland
6. Ziel des Designstudiums
7. Materialien der Moderne
8. Geschichte der Design-Studiengänge
A. Blicken wir
zurück, dann war der Beginn der zweiten Hälfte der 1990er Jahre von
einem Wahrnehmungswandel des Automobils in der Öffentlichkeit
gekennzeichnet. Plötzlich gab es etwas zu entdecken auf Deutschlands
Straßen: Reihenweise spannende Autos. Ausgelöst hatte diesen Wandel ein
großer Qualitätssprung nicht nur in der Fahrzeugtechnologie, sondern
vielmehr im Design der Automobile.B. Die Mehrzahl der
Design-Studiengänge in Deutschland ist aus der Ausbildung an
Kunstgewerbeschulen hervorgegangen, deren Großteil zwischen 1860 und
1880 entstand. Hinzu kamen Akademien und Hochschulen für angewandte
Kunst wie zum Beispiel das Bauhaus in Dessau. Daneben gibt es
Meisterschulen für das Schneiderhandwerk, von denen manche Ende des 19.
Jahrhunderts entstanden.
C. Auf die Frage, welche Dinge für Deutschland typisch
sind, kommt den meisten Menschen vermutlich nicht als erstes das Design
in den Sinn. Zwar hat deutsches Design weltweit einen sehr guten Ruf,
aber es sind eher die Kräfte im Verborgenen, die diesen Ruf
verantworten: Deutsches Design funktioniert, ist technisch ausgereift
und von hoher ästhetischer Qualität.
D. Stahl, Kunststoff und Glas bilden die
Materialpalette des deutschen Designs. Es sind die Materialien der
Moderne, die überall in der industrialisierten Welt benutzt wurden und
in ihrer nationalen Anonymität zugleich eine große Symbolkraft haben.
Das globalisierte Produkt war bereits Realität, bevor die Diskussion
darüber begann, wie es aussehen soll.
E. Eine Vielzahl von Universitäten, Kunsthochschulen,
Hochschulen und Akademien bieten Modedesign als Studium an. Die
Ausbildung an den Hochschulen, Akademien und Meisterschulen in
Deutschland haben ein hohes Niveau. Manche sind mehr künstlerisch
orientiert, wie die Hochschule der Künste Berlin, andere sind stärker
Business orientiert wie die Akademie ModeDesign.F. Gerade im
Zeitalter kommunikativer und visueller Medien hat das Bild vom Menschen
einen hohen Stellenwert. Mode zu entwerfen, bedeutet das Erkennen der
unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen und erfordert
ein hohes Maß an Kreativität. Modedesign arbeitet an der Schnittstelle
zwischen Mensch und Umwelt und macht den Bezug zwischen Kleidung und
Gesellschaft bewusst.
G. Das Berufsfeld des Modedesigners umfasst Planung und
Gestaltung von Bekleidung im weitesten Sinne. Berufliche Möglichkeiten
findet der Designer oder die Designerin in Deutschland vorwiegend im
Kreativbereich der Bekleidungsindustrie. Sie reichen vom Entwurf
gezielter Prototypen über die Gestaltung individueller Massenproduktion
für Kunden und über die Entwicklung einer kompletten Modekollektion bis
zur Mitwirkung im Produktmanagement. B3 Прочитайте текст и заполните пропуски
A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в
списке 1–7 лишняя. Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть
предложения, в таблицу.
Vielfältig und dynamisch: Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land
Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land ist vielfältiger und
dynamischer als sein Ruf. Der Sparzwang in den Kommunen hat viele Bühnen
erfinderisch gemacht. Aber auch an A
______________________ sind in den letzten Jahren Strukturen
modernisiert und deshalb kostengünstiger geworden. Eine umfangreiche
Autorenförderung trägt dazu bei, dass B ______________________.
Wettbewerbe wie das Mülheimer Stückefestival oder der Berliner
Stückemarkt, Werkstatt- und Autorentage wie in Hamburg, München oder
Heidelberg fordern und C ______________________. Nicht
zuletzt arbeiten allen Sprachbarrieren zum Trotz immer wieder
weltberühmte Regisseure aus dem Ausland im deutschen Theater. Die
Initialzündung zu solchen Kooperationen D ______________________
wie Theater der Welt (dieses Jahr in Stuttgart), Theaterformen (bislang
in Braunschweig/Hannover) oder Neue Stücke aus Europa (Wiesbaden). Wenn
in der so genannten Provinz die Theater auch selten definieren, was
gerade republikweit als letzter «Bühnenschrei» gilt, bilden sie doch
häufig E ______________________. Sie binden Rentner und
Schulklassen ein, stärken das Selbstbewusstsein einer Stadt, bieten
ihrem Publikum ein Forum. In den Großstädten leisten wiederum
Theaterprojekte, in denen etwa Migranten, Obdachlose, behinderte
Darsteller oder Gefängnisinsassen auf der Bühne stehen, über die Kunst
hinaus solche soziale Integrationsarbeit. F ______________________, dass das bürgerliche Theater neugierig bleibt und offen.
1. das Literaturtheater nicht zum Archiv verstaubt
2. hat sich vieles verändert
3. den Knotenpunkt kulturellen Lebens in der Region
4. den großen und berühmten Theatern
5. und sie alle tragen dazu bei
6. fördern die zeitgenössische Theatertextproduktion
7. geben oft internationale Festivals Прочитайте текст и выполните
задания А15–А21. В каждом задании обведите цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
Ohne Auto? Nein, danke!
Verstopfte Straβen. Die ewige Suche nach Parkplätzen. Stinkende Staus in
ständig wachsenden Blechlawinen. Über 40 Millionen Fahrzeuge rollen auf
Deutschlands Straβen – und täglich werden es mehr. Welcher Autofahrer
gibt nicht längst zu, dass er manchmal reichlich genervt ist? Und ein
schlechtes Gewissen haben wir auch. Denn wir hören täglich die Meldungen
über verpestete Luft, Ozonloch, Waldsterben, das die sich immer
vergrößernde Flotte auf vier Rädern verursacht. Na und? Deshalb den
Wagen gleich ganz abschaffen? Da sagen spontan fast alle erst einmal
«Nein. Kommt für uns nicht in Frage”. Aber eines ist für sie klar, es
ist höchste Zeit nach langfristig vernünftigen Lösungen zu suchen.
Einige Möglichkeiten, die Nerven und die Umwelt, vielleicht auch den
Geldbeutel gleich mitzuschonen, bringt Journal für Deutschland.
Vielleicht ist ja ihr Zukunftsmodell dabei.Auf Platz eins rangieren
Fahrgemeinschaften. Die Idee ist einfach. Wer zusammen arbeitet, fährt
gemeinsam ins Büro. Treffpunkt ist zum Beispiel eine Autobahnbrücke:
Dort steigen alle in ein Fahrzeug um. Spart Geld, hat sich schon
tausendfach bewährt. Beispiel Ludwigshafen. Drei Frauen. Ein
Arbeitsplatz. Kommunikationskauffrau Claudia Remmele: «Wir kennen uns
seit der gemeisamen Ausbildung, wohnen alle in der Nähe. Die Firma ist
rund 50 Kilometer entfernt. Auf Bus oder Bahn umsteigen? Da wären wir
eine Stunde zu früh im Büro. So kamen wir auf die Idee. Zwei Autos
bleiben stehen, in einem fahren wir zu dritt.”
Abwechselnd, reihum, jede Woche wird das Fahrzeug gewechselt. Die
18jährige: «Das war damals vor allem praktisch, weil wir uns vor
Prüfungen gegenseitig noch schnell abfragen, austauschen konnten während
der Fahrt. Seit dem Sommer arbeiten wir in verschiedenen Abteilungen,
aber es gab noch nie Probleme, wir sind uns immer einig.” Die Firma
belohnt das Trio durch ein Bonusprogramm: Wer als Fahrgemeinschaft
kommt, darf die Firma- Parkplätze in der unmittelbaren Nähe vom
Haupteingang bekommen.
Car-Sharing ist ideal für Nachbarn, Freunde, die aus Kostengründen oder
Überzeugung umweltbewusster leben wollen. Musterverträge, in denen alle
Streitfälle geregelt sind, gibt es bei allen Automobilclubs. So teilen
sich zum Beispiel in Warendorf zwei Familien ein Auto. Ursula Gehrs:
”Die Idee ergab sich von selbst. Erst brauchte ich mein Auto regelmäβig,
weil Bus- und Bahnverbindungen zur nächsten Groβstadt zu schlecht sind,
was bis zum Herbst 2006 dauerte. Da habe ich zum ersten Mal überlegt,
dass der Wagen im Grunde zu teuer wird. Aber ohne Auto wäre ein
Groβeinkauf für die Familie nicht vorstellbar. Wie auch mit drei Kindern
im Alter zwischen 7 und 16 mal die Oma zu besuchen. Die Lösung brachte
ein Gespräch mit meiner Freundin Hedwig, die schon lange ein Auto
vermisste. Nicht für den Alltag, aber für Dringendes. Jetzt kann sich
ihre Familie ein «halbes” leisten. Das funktioniert so: Beide fahren den
Wagen (weiterhin zugelassen auf den Namen der Freundin) je eine Woche
lang. Wer das Auto benutzt, zahlt 30 Cent Kilometergeld (Reparaturund
Wartungskosten inklusive). Die Fixkosten werden geteilt. Alles läuft
prima!”
Stattauto kommt aus Amerika und gibt es schon in 40 deutschen Städten.
Wer ein Auto braucht, mietet es stunden-, tage-, wochenweise zum
Minimaltarif. Der einzige Nachteil ist es, dass ein Stattauto nur für
Mitglieder dieser Initiative mietbar ist. Beispiel Hamburg. Gisela
Ockelmann will aus Überzeugung kein eigenes Auto, weil sie meist mit dem
Rad fährt. «Trotzdem gibt es Situationen, da brauche ich dringend eins
und möchte auf diesen Anspruch nicht verzichten.” Sie trat der
Initiative bei – Aufnahmegebühr 100 Euro, monatlicher Vereinsbeitrag –
20 Euro, Kaution 500 Euro. Dafür ist sie mobil, wenn sie es will.
A15 Was gehört nicht zu Stressfaktoren für deutsche Autofahrer?
1) Giftige Abgase.
2) Langes Warten.
3) Mangel an Parkplätzen.
4) Nicht immer verständliche Verkehrsregeln.
A16 Die meisten Fahrer sind zur Erkenntnis gekommen, dass
1) auf Autofahrten möglichst oft verzichtet werden sollte.
2) die Luft nicht verpestet werden darf.
3) nach Alternativen gesucht werden muss.
4) das Waldsterben nicht so spurlos ist.
A17 Was wäre keine Voraussetzung für eine Fahrgemeinschaft?
1) Wohnen nah voneinander.
2) Entfernter Arbeitsplatz.
3) Unbequeme Fahrpläne.
4) fehlende Belohnung durch die Firmaleitung.
A18 Die Vergünstigung für Gemeinschaftsfahrer ist die Möglichkeit, …
1) eine Stunde später zur Arbeit zu kommen.
2) das Auto am von der Firma reservierten Platz zu parken.
3) von der Firma an einen höheren Posten versetzt zu werden.
4) mit seinen Freunden in einer Abteilung eingestellt zu werden. A19 Car-Sharing bedeutet, dass …
1) zwei oder mehrere Familien ein Auto benutzen.
2) eine Familie ein Auto nur für Groβeinkauf leiht.
3) man zusammen an Werktagen zur Arbeit fährt.
4) ein Auto an die Nachbarn für Urlaubsreisen verliehen wird. A20 Ursula entschied sich zu Car-Sharing, weil …
1) sie Mitleid mit ihrer Freundin hatte.
2) sie mit Kindern sehr selten auf Achse ging.
3) ihre eigene Familie finanziell überfordert wurde.
4) ihre Freundin längst von einem neuen Auto geträumt hatte. A21 Die Zahl der «Stattauto”-Anhänger nimmt zu, weil …
1) die Wartung zu stressig ist.
2) die Fahrsteuer ständig gesteigert wird.
3) sich wenige ein Auto leisten können.
4) viele nur ab und zu auf ein Auto angewiesen sind. По окончании выполнения заданий В2, В3
и А15–А21 НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ СВОИ ОТВЕТЫ В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что ответы на задания В2, В3, А15–А21 располагаются в
разных частях бланка.
Раздел 3. Грамматика и лексика
Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если
необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк,
обозначенных номерами B4–B10, так, чтобы они грамматически
соответствовали содержанию текстов. Заполните пропуски полученными
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы
B4–B10. Überrasch mal deinen Lieblingslehrer!
B4 Was schenkt man einem beliebten Lehrer, der __________________ wird?
PENSIONIEREN
B5 Schüler im sächsischen Ebersbach kamen auf eine ganz
besondere Lösung. Sie __________________ den Lehrer und seine Frau in
ein Dresdner Hotel ein.
LADEN
B6 Zur Begrüßung schenkten die Schüler den beiden Sekt ein und trugen die Taschen __________________ Gäste auf das Hotelzimmer.
IHR
B7 Ein __________________ Menü war für beide da schon serviert. Danach führten sie sie in die Dresdner Oper aus.
FÜRSTERLICH
„Big Brother»
B8 Man kann zur Zeit im deutschen Fernsehen sehen, wie Menschen 100 __________________ zusammen in einem Containerhaus wohnen.
TAG
B9 Jede Woche muss einer das Haus verlassen –
ausgewählt von __________________. „Big Brother» heißt die Show, die vor
allem bei Jugendlichen beliebt ist.
FERNSEHZUSCHAUER
B10 „Big Brother» stand übrigens in dem Roman „1984″
von George Orwell für die totale Überwachung der Menschen in einem
totalitären Staat. Doch das __________________ man heute offenbar nicht
mehr ganz so ernst
NEHMEN Прочитайте приведенный ниже
текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными
буквами в конце строк, обозначенных номерами В11–B16, так, чтобы они
грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните
пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному
заданию из группы В11–В16.
B11 Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch wird in Köln
gefeiert. Wer Mitte Februar nach Köln kommt, fühlt sich in die Tage der
Winterschluss-Verkäufe zurückversetzt. Im größten Karnevalskaufhaus
Deutschlands drängen sich die Narren auf der __________________ nach dem
geeigneten Kostüm.
SUCHEN
B12 Rund 15.000 Kunden kommen in den Wochen vor Rosenmontag hierher — und das __________________.
TAG
B13 Der Geschäftsführer des ‘Karnevalswierts’, erklärt
warum Karnevalisten nicht bei __________________ und Zubehör sparen:
«Der Kölner nimmt sich alles für Karneval — weil das hier wie eine
Religion ist.»
VERKLEIDEN
B14 Neben Kostümen sind in den närrischen Tagen
__________________ der Renner. 150 Tonnen Pralinen, Bonbons und
Schokolade werden in Köln am Rosenmontag von den Festwagen in die
jubelnde Menge geschmissen.SÜß B15 In der gesamten
Zeit erwirtschaftet Köln nach eigenen Angaben 330 Millionen Euro. Daraus
fließen rund acht Millionen Euro in die Stadtkassen zurück. 1,5
Millionen __________________ pilgern jedes Jahr an Karneval nach Köln.
BESUCHEN
B16 Aus dem Ausland kommen vor allem __________________
Franzosen und Niederländer. Der Karneval ist ein Segen für die Stadt,
weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine fünfte Jahreszeit
ist. Ein Zusatzgeschäft, das ansonsten nicht stattfinden würde.
BELGIEN Прочитайте текст с пропусками,
обозначенными номерами А22–А28. Эти номера соответствуют заданиям
А22–А28, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите
номер выбранного вами варианта ответа.
Täglich erscheinen in Deutschland mehr als 200 neue Bücher, da verlieren
selbst interessierteste Leser den Überblick. Mehr als 3.300 Buchverlage
A22 ______ jährlich fast 80.000 Titel auf den Markt. Da bleibt nichts unbeschrieben. Ungelesen dagegen muss A23 ______ bleiben, denn die Zeit eines Menschenlebens und die Lesezeit sind A24 ______
.Verloren wären wir in der Welt der Bücher, wenn es die Bestsellerliste
nicht gäbe. Um einen genauen und übersichtlichen Vergleich von
Verkaufsdaten
ermöglichen zu können, rief die Literaturzeitschrift „The Bookman» die
erste Bestsellerliste bereits 1895 ins Leben. Es war der amerikanische
Journalist Harry Thurston Peek, der auf die A25 ______
kam, für seine Zeitschrift eine Liste der meist verkauften Bücher
aufzustellen. In Deutschland diktieren Bestsellerlisten seit 1972 die
Trends in der Welt der Bücher. Jeden Montag erscheint die Liste im
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel». Die Bestsellerliste soll eine A26 ______ auf dem großen Buchmarkt schaffen, Empfehlungen A27 ______ und aufzeigen, welche Themen und Bücher gesellschaftlich wichtig sind. Kurz: sie A28 ______
den Leser an der Hand. Gleichzeitig dirigiert sie den Buchmarkt: Nach
der Liste der Verkaufsschlager werden die Regale der Buchhandlungen
sortiert. A22 1) geben 2) nehmen 3) bringen 4) holenA23 1) nichts 2) vieles 3) alles 4) weniges
A24 1) unbegrenzt 2) begrenzt 3) unendlich 4) schön
A25 1) Idee 2) Einfall 3) Gedanke 4) Weise
A26 1) Begrenzung 2) Bedeutung 3) Entscheidung 4) Orientierung
A27 1) geben 2) abgeben 3) angeben 4) aufgeben
A28 1) führt 2) schlägt 3) reicht 4) zeigt По окончании выполнения заданий
В4–В16, А22–А28 НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ СВОИ ОТВЕТЫ В БЛАНК ОТВЕТОВ №1!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что ответы на задания В4–В16, А22–А28 располагаются в
разных частях бланка. При переносе ответов в заданиях В4–В16 буквы
записываются без пробелов и знаков препинания.
Раздел 4. Письмо
Для ответов на задания С1 и С2 используйте бланк ответов № 2. При
выполнении заданий С1 и С2 особое внимание обратите на то, что ваши
ответы будут оцениваться только по записям, сделанным в бланке ответов №
2. Никакие записи черновика не будут учитываться экспертом. Обратите
внимание также на необходимость соблюдения указанного объёма текста.
Тексты недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая
требуемый объём – не оцениваются. Запишите сначала номер задания (С1,
С2), а затем ответ на него. Если одной стороны бланка недостаточно, вы
можете использовать его другую сторону. C1 Sie haben 20 Minuten, um diese Aufgabe zu machen.
Ihr deutscher Brieffreund Udo aus München schreibt über seine letzte Hausaufgabe in Deutsch:
… Alle Schülerinnen und Schüler unserer Klasse sollen in einem
Kurzvortrag den Inhalt eines Jugendbuches vorstellen. In diesem
Kurzvortrag sollen wir in der Klasse einen möglichst vollständigen, aber
nicht zu langen Überblick über den Inhalt geben. Wie mache ich das bei
einem Buch, das vielleicht 130 Seiten hat? Welche Aufgaben kriegst du?
Was fällt dir schwer? Welche Aufgaben findest du besonders interessant?
… Am Wochenende macht unsere Klasse einen Ausflug an den Bodensee…
Nun möchten Sie Udo über Ihre Schulaufgaben erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:• Udos Fragen beantworten;
• 3 Fragen zu seiner Klassenfahrt formulieren.Der Brief soll 100 – 140 Wörter enthalten.
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. C2 Sie haben 40 Minuten, um diese Aufgabe zu machen.
Kommentieren Sie die folgende Aussage:
«Einer, der seine Schulfreunde bei sich nicht abschreiben lässt, ist kein echter Freund».
Nehmen Sie Stellung zu diesem Problem. Halten Sie sich an folgenden Plan:
• Einleitung – erklären Sie das Problem in allgemeinen Zügen;
• Ihre persönliche Stellungnahme zum Problem; erläutern Sie Ihre Meinung;
• nennen Sie Gegenargumente und erklären Sie, warum Sie mit diesen nicht einverstanden sind;
• Schlussfolgerungen: Formulieren Sie ein abschließendes Urteil.Der Umfang Ihres Textes: 200–250 Wörter.
Тексты для аудирования:
Вы сейчас будете выполнять тест по аудированию. Во время его выполнения
перед каждым заданием дана пауза, с тем чтобы вы смогли просмотреть
вопросы к заданию, а также паузы после первичного и повторного
предъявления аудиотекста для внесения ответов. По окончании выполнения
всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов.
Задание В1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями
каждого говорящего 1–6 и утверждениями, данными в списке A–G.
Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой,
только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите
запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд,
чтобы ознакомиться с заданием.
Wir beginnen jetzt.
Sprecherin 1
Meine Gedanken drehten sich öfter um Musik, und ich hatte immer mehr
Lust, dazu beizutragen, dass die klassische Musik nicht zu einem Museum
wird. Jahrzehntelang hatte ich auf einem zweihundert Jahre alten
Instrument alte Musik gespielt. Warum? Weil es einfach mehr tolle Musik
von gestern gibt als von heute, so scheint es mir zumindest. Ich komme
immer wieder zu dieser Musik zurück, und doch lebe ich heute und will
etwas hören, was zu mir als einem Menschen von heute passt.
Sprecher 2
Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, Schlagzeug zu lernen. Jetzt
habe ich also ein Schlagzeug. Es steht in unserer Küche. Unten probt die
Nachbarband experimentelle Rock-Jazz-Musik, meine ersten Versuche hören
sich auch recht experimentell an. Glücklicherweise lebe ich in einem
Künstlerhaus, es haben sich mir schon drei Schlagzeuglehrer zu
unterschiedlichen Bedingungen angeboten. Jetzt muss ich nur noch
anfangen, ich bin ganz aufgeregt.
Sprecher 3
Im Orchester der Musikschule wurde ich mit vierzehn nicht gebraucht.
Angeblich gab es da genug Geiger, und ich spielte nicht gut genug Geige,
meinte die Leiterin … Ich begann, richtig zu üben. Ich wollte ins
Orchester. Endlich durfte ich ins Orchester, und zum ersten Mal klang es
gut, was ich machte. Zum Glück war mein erster Orchesterkomponist
Tschaikowsky: große Linien, heroische Harmonien, Blechbläserrufe wie von
Ozeandampfern…
Sprecherin 4
Ich singe alles mit. Ich merke mir Texte und Melodien, kann gar nicht
anders. Und wenn mich niemand hört, singe ich mit. Sonst natürlich auch,
aber dann nur leise in mich hinein. Singe ich gut? Eher nicht. Nur
wenige Menschen haben Singstimmen. Die anderen verstecken sich in
Chören, deren Mittelwert allen erträglich klingt. Doch der Gesangsverein
ist nicht meine Welt. Ich singe nur zum Spaß – und hoffe, dass man es
nicht im ganzen Haus hört.
Sprecher 5
Kannst Du singen? Wie bitte soll ich diese Frage verstehen? Wenn es im
Konzert oder beim Anhören von Musik jedoch um das Mitsummen, Mitsingen
gar Mitgrölen geht, so stehe ich immer in vorderster Reihe, wenn ich den
Song oder die Gruppe mag. Texte kann ich zwar selten auswendig, wenige
Ausnahmen wie z.B. einige Songs von meinen liebsten Alben und Bands
bilden da die einzige Ausnahme.
Sprecherin 6
Kann man Musik unterrichten, ohne eigene Gefühle beim Hören zu haben und
zu zeigen? Ich bin Zuhörer, Beobachter, Kritiker – muss also selbst von
dem begeistert sein, was ich anbiete. Irgendein Zugang zum Werk oder
zum Hörer findet sich dann doch. Schließlich handelt ja jede Art von
Musik von etwas Menschlichem. Aber man kann nicht gezwungen werden,
etwas zu lieben, das nicht.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15 Sekunden.)
Jetzt hören Sie die Texte das zweite Mal. (Wiederholung.)
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)
Задания А1–А7
Вы услышите разговор друзей. Определите, какие из приведенных
утверждений А1–А7 соответствуют содержанию текста (1 – Richtig), какие
не соответствуют (2 – Falsch) и о чем в тексте не сказано, то есть на
основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа
(3 – Nicht im Text). Обведите номер выбранного вами варианта ответа. Вы
услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с
заданиями. Wir beginnen jetzt.
Karolin: Hallo Michael, ich bin so froh dich in Paris zu sehen. Ich habe
gehört, dass du auch dein Berufspraktikum bei einer französischen Firma
machst. Michael: Genau, ich arbeite bei Douge International in der Nähe
der Champs Elysees.
Karolin: Wie viele Stunden arbeitest du täglich?
Michael: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Ich komme morgens kurz vor
9 im Büro an und schließe alle Bürotüren auf. Um 9 Uhr sind dann auch
die anderen Mitarbeiter da. Dann kümmere ich mich um die Post und um
sonstige Dinge, die so anfallen. Falls ein Klient zu einem Treffen
vorbeikommt, empfange ich ihn und bereite alles für das Gespräch vor.
Und wie sieht dein Tag aus?
Karolin: Ich komme morgens um 9 Uhr an. Dann setze ich mich an den
Computer, arbeite entweder an einer Power Point Präsentation, die ich
bereits angefangen habe, oder an einem anderen Dokument … Die meiste
Arbeit findet am Computer statt.
Michael: Wie ist der Umgang mit dir als Praktikantin aus Deutschland?
Karolin: Super!!! Alle sind sehr nett, hilfsbereit und freundlich. Sie
sind sehr daran interessiert, dass mir die Arbeit gefällt und dass ich
mit meinem Französisch «vorankomme». Michael, sprichst du gut
Französisch? Hast du einen Sprachkurs gemacht?
Michael: Ich habe keinen gemacht, da meine Sprachkenntnisse auf Niveau
B2 waren, hat auch gereicht, denn man lernt während des Praktikums
sowieso sehr viele neue Wörter, die man auch während eines Sprachkurses
nicht lernen würde.
Karolin, sind dir in deinem Arbeitsalltag schon Unterschiede zur Berufswelt in Deutschland aufgefallen?
Karolin: Unterschiede kann ich nicht beurteilen, da es das erste Mal für
mich ist, dass ich in so einem Unternehmen arbeite. Das Verhalten am
Arbeitsplatz ist sehr freundlich. Alle duzen sich, auch den Chef. Der
Dresscode ist sehr schick.
Die Männer immer in Anzug (mit Krawatte) und die Frauen entweder in
Hosenanzügen, Röcken oder Kleidern. Jeans, Sportschuhe und dergleichen
sind nicht erwünscht.
Michael: In meiner Firma ist der Umgang auch sehr freundlich, alle sind immer sehr entspannt und nie gestresst!!!
Karolin: Und wenn es ein Problem gibt, was machst du dann?
Michael: Dann kann ich jederzeit zu jedem, auch zum Chef (obwohl der
natürlich sehr beschäftigt ist) gehen. Alle tragen dazu bei, dass man
sich bereits in so kurzer Zeit als Teil der Firma fühlt.
Karolin, bald kehren wir nach Deutschland zurück. Wie wirst du deine
jetzigen Erfahrungen als Praktikantin im Ausland in Deutschland nutzen?
Karolin: Das Praktikum gefällt mir sehr gut und das zeigt mir, dass ich
das richtige Studienfach gewählt habe, da die Arbeit viel von meinem
Studium beinhaltet. Ich merke außerdem auch wie sich mein Französisch
verbessert und das ist mir in meinem Studium ebenfalls sehr von Nutzen.
Alles in allem ist es eine sehr gute und wichtige Erfahrung und es wird
daher bestimmt nicht mein letztes Praktikum im Ausland gewesen sein.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15 Sekunden.)
Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal. (Wiederholung.)
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)
Задания А8–А14
Вы услышите интервью. В заданиях А8–А14 обведите цифру 1, 2 или
3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись
дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Wir beginnen jetzt.
Der Graffitibotschafter
Seit zwei Jahren reist Julian Vogel in Krisengebiete. Er malt Graffitis an Wände und will so Frieden stiften.
jetzt.de: Julian, was ist eine «Peace Wall»?
Julian Vogel: Alle Wände sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: Im
Hintergrund findet sich die blau-weiße Friedenstaube sowie die
Landesflagge des jeweiligen Landes. Das Hauptmotiv bezieht sich auf die
vorherrschende Situation vor Ort oder die Kultur und ist für die
Menschen vor Ort leicht verständlich. Außerdem ist ein Slogan in der
Landessprache eingebaut, der sich mit dem Thema Frieden
auseinandersetzt.
jetzt.de: Wie war es, als du den Irak besucht und deine erste Peace Wall gemalt hast?
Vogel: Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich zu Fuß die Grenze überschritt.
Schließlich habe ich täglich die Schreckensnachrichten des Krieges verfolgt.
Selbst das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft in Bagdad rieten
mir ab, in den Irak zu kommen. Im Notfall „könnten sie mir keinerlei
Hilfe gewähren».
Doch ich habe meinem Freund und Begleiter Karwan geglaubt, dass ich bei
seiner Familie gut aufgehoben sei und mir keine Sorgen zu machen
bräuchte.
jetzt.de: Wie war die Reaktion der Einheimischen auf deine Friedensmalerei?
Vogel: Beeindruckend. Scharen von Kindern kamen aus dem Nachbardorf,
Reisebusse hielten an, um Fotos von der Wand zu machen. Radio- und
Fernsehteams begleiteten meine Arbeit. Es war nicht nur das Bild, das
Symbolwert hatte, sondern auch die Wand, die zu einem ehemaligen
Palastbau des Diktators Saddam Hussein gehört hat.
jetzt.de: Du hast schon viele Länder besucht und dort deine Peace Wall verewigt. Nach welchen Kriterien wählst du die Orte aus?Vogel: Zum Teil sind es Krisengebiete, zum Teil aber auch Kulturhochburgen, soziale Brennpunkte oder einfach Orte des Friedens.
jetzt.de: Welche Orte haben dich besonders beeindruckt?
Vogel: In Indien habe ich Freundschaft mit Jugendlichen geschlossen, die
auf Hausbooten vor meiner Wand gewohnt haben. Sie haben mir Tipps
gegeben, wie ich mich zurechtfinden kann. Oft saßen wir am Ufer und
haben Erfahrungen und Geschichten aus unseren Kulturen ausgetauscht. In
Kingston habe ich einen Jungen namens Richard kennengelernt, der uns
später zu sich nach Hause eingeladen hat. Wir haben seine Familie
kennengelernt und er hat mir seine Zeichnungen gezeigt. Das besondere
war, dass er in einem sehr armen Viertel von Kingston gewohnt hat, das
ohne Begleitung nicht von einem Weißen betreten werden konnte. Es war
sehr eindrucksvoll zu sehen, wie sich das Leben dort abspielt.
Von Martin, dem Sprecher des Bürgermeisters von Gulu/Uganda, habe ich
erfahren, was das Leben in einem Bürgerkrieg bedeutet. Er hat von seiner
Arbeit während der Unruhen und seinen persönlichen Begegnungen mit dem
Rebellenführer erzählt.
jetzt.de: Hast du brenzlige Situationen erlebt?
Vogel: Natürlich bin ich auch in Situationen gekommen, in denen ich mich
unwohl gefühlt habe — wie zum Beispiel beim Grenzübertritt vom Irak in
die Türkei, als wir sehr unsanft vom Militär bis auf die Unterhosen
gefilzt wurden.
Auch in Uganda sind wir gerade noch rechtzeitig an einem Aufstand von
Einheimischen durch brennende Barrikaden aus der Stadt gekommen.
jetzt.de: Auf deinen Reisen arbeitest du mit regionalen Sprayern zusammen.
Wer ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Vogel: Sehr bewegt hat mich die Zusammenkunft mit INK76, einem New
Yorker Graffiti Künstler. Wir haben viele Abende vor einem
Benzin-Heizlüfter mit Budweiser verbracht und er hat wahnsinnig viele
Geschichten erzählt.
jetzt.de: Du finanzierst das Projekt größtenteils über Spenden und reist
dabei quer durch die Weltgeschichte. Wurde dir schon vorgeworfen, nur
zu reisen und Spaß zu haben? Wo bleibt deine echte Hilfe?
Vogel: Zwar hat mich dieser Vorwurf noch nicht erreicht, aber ich bin
mir bewusst, dass es für einen Außenstehenden den Anschein haben mag,
dass ich das Ganze nur „just for fun» mache. Mir macht die Arbeit
wahnsinnig Spaß. Es ist aber auch ein sehr großer finanzieller und
zeitlicher Aufwand, da das ganze Projekt momentan eine
Ein-Mann-Organisation ist.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15 Sekunden.)
Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal. (Wiederholung.)
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)
Das ist das Ende der Aufgabe zum Hörverstehen.
Ответы
| Раздел 1. Аудирование | Раздел 2. Чтение | Раздел 3. Грамматика и лексика | |||
| No задания | Ответ | No задания | Ответ | No задания | Ответ |
| А1 | 2 | А15 | 4 | А22 | 3 |
| А2 | 2 | А16 | 3 | А23 | 2 |
| А3 | 2 | А17 | 4 | А24 | 2 |
| А4 | 3 | А18 | 2 | А25 | 1 |
| А5 | 2 | А19 | 1 | А26 | 4 |
| А6 | 1 | А20 | 3 | А27 | 1 |
| А7 | 1 | А21 | 4 | А28 | 1 |
| А8 | 2 | ||||
| А9 | 1 | ||||
| А10 | 3 | ||||
| А11 | 2 | ||||
| А12 | 1 | ||||
| А13 | 2 | ||||
| А14 | 3 |
| Аудирование | |
| В1 | BDAGEC |
| Чтение | |
| В2 | 3817542 |
| В3 | 416735 |
| Грамматика и лексика | |
| В4 | pensioniert |
| В5 | luden |
| В6 | ihrer |
| В7 | fursterliches |
| В8 | Tage |
| В9 | Fernsehzuschauern |
| В10 | nimmt |
| В11 | Suche |
| В12 | täglich |
| В13 | Verkleidung |
| В14 | Süßigkeiten |
| В15 | Besucher |
| В16 | Belgier |
*Написание ответов (без пробелов и знаков препинания) соответствует инструкции ФЦТ по заполнению бланка ответов № 1.
© 2011 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
Опубликовано: 15 декабря 2010
Шпаргалка
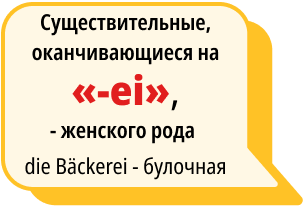
Хотите вернуться к этой странице позднее?
Мы отправим её на вашу почту!
Сейчас читают
Der Volkswirt Niko Paech bezeichnet sich als „Postwachstumsökonom“. Fragt man ihn, so führt das allgemeine Streben unseres Wirtschaftssystems nach immer größerem Wachstum ins ökologische und soziale Verderben. Nicht nur das – jeder einzelne werde früher oder später überfordert sein und auf einen Konsum-Burnout zusteuern. Soweit die These – und die praktische Erfahrung? Der vorweihnachtliche Kaufrausch schien ja auch in diesem Jahr wieder ungebrochen. Also haben wir mal nachgefragt.
Fluter: Wenn ich zurzeit durch die großen Shopping-Malls laufe, habe ich erstmal gar nicht den Eindruck, dass da viele Leute kurz vor dem Konsum-Burnout stehen. Wo sehen Sie Anzeichen dafür?
Niko Paech: Heroinsüchtige sehen auch nicht so aus, als hätten sie etwas gegen den Stoff einzuwenden, sie betteln sogar darum. Menschen kaufen Dinge wegen ihrer emotionalen, vor allem auch symbolischen Funktionen, zuweilen sogar aus defensiven Erwägungen: Wenn mein Dresscode oder Smartphone nicht dem Standard meiner Arbeitskollegen entspricht, stehe ich wie ein Freak da. Wenn ich meinen Kindern keine hinreichende Konsumausstattung gewähre, gelte ich als asozial, reaktionär oder prekär. Der damit erzeugte Stress untergräbt unsere psychische Gesundheit, was an vielen Symptomen abzulesen ist.
Sie sprechen von einem zunehmenden „Konsum-Burnout in der modernen Bequemokratie“.
Ich benutze diesen Begriff als Metapher für eine Situation, in der die psychischen Ressourcen nicht mehr ausreichen, jene Dinge stressfrei zu verarbeiten, die wir uns kaufen. Menschliche Ressourcen, die zur Verarbeitung von Information und zum Genuss vonnöten sind, speisen sich aus Zeit. Aber Zeit wird mit zunehmender materieller und terminlicher Überhäufung immer knapper. Jede Information, jeder Reiz und jede bewusste Handlung verschlingt ein Quantum der nicht vermehrbaren Zeit, weil Menschen nicht multitaskingfähig sind. Das endet in einer Paradoxie: Wir werden rechnerisch immer reicher, während wir innerlich veröden. Schauen Sie sich den phänomenalen Zuwachs an Antidepressiva-Verschreibungen an.
Aber das hat doch vermutlich nicht zuerst mit Konsumdruck, sondern mit dem heutzutage allgemein hohen Zeit- und Leistungsdruck zu tun.
Der allgemeine Leistungsdruck kommt erschwerend hinzu. Insbesondere der Mobilitäts- und Kommunikationszwang sowie das, was das Arbeitsleben abverlangt. Die Grenze zwischen privater und beruflicher Sphäre wird zusehends nebulös, vor allem aufgrund ortsungebundener Handlungen mit Hilfe von digitalen Medien.
Warum glauben Sie, dass die Menschen durch das große Angebot unter Druck geraten? Jeder kann sich doch ein paar wenige Dinge rauspicken.
Neben der sozialen Funktion des Konsums gibt es eine emotionale Dimension: Es geht hier oft um Kompensation – sich durch kurzfristige, oft blitzartige Kauferlebnisse einen Kick zu geben, der von einer zunehmenden Orientierungslosigkeit ablenkt. Wie bei einer Droge oder einem Schiffbrüchigen, der seinen Durst mit Salzwasser stillen will, wird das Problem damit aber nur verschärft, und die nötige Dosis nimmt zu.
Wie reagieren die Menschen auf den steigenden Konsumdruck?
Die Reaktionsmuster sind unterschiedlich. Sie reichen von der Konsumverweigerung, die nur eine Minderheit praktiziert, bis zur bequemen Konstruktion von Ausreden, für die sogar nach wissenschaftlichen Grundlagen gesucht wird. Schauen Sie sich jene Medien- und Erziehungswissenschaftler an, die nicht nur begründen, warum jeder Fünfjährige ein Tablet haben sollte, sondern sogar darlegen, warum Computerspiele hinsichtlich ihrer Wirkung auf Kinder differenziert zu sehen und gar nicht unbedingt abzulehnen seien. Vor allem wird jede konsumkritische Diskussion als freiheits- und fortschrittsfeindlich gebrandmarkt – gerade von den Intellektuellen.
Der Anbieter von persönlichen Events und Extremsporterlebnissen „Jochen Schweizer“ wirbt mit dem Slogan: „Du bist, was du erlebst“. Gibt es die Angst, aus Erlebnismangel nichts mehr zu gelten?
Märkte und Menschen offenbaren materielle Sättigungsgrenzen. Deshalb lässt sich die Konsumdynamik nur fortsetzen, wenn es regelmäßig zu sprunghaften Neuerungen kommt. Was materielle Güter zur Identitätsbildung beizutragen vermögen, ist in modernen Konsumdemokratien weitgehend ausgeschöpft. Die darauf folgende Steigerungsstufe besteht dann eben darin, den individuellen Aktionsradius auszuweiten, um mehr aus sich rauszuholen im Sinne des Konsums von Erlebnissen.
Ich selbst als über 40-Jähriger finde mich in Ihrer These durchaus wieder. Aber junge Menschen empfinden das doch meist ganz anders und sind noch nicht so gesättigt.
Wissen Sie, es bedarf einer Fortschrittsgläubigkeit, die ich nicht habe, um sich über die Begrenztheit psychischer Ressourcen hinwegsetzen zu wollen. Die jungen Leute sind einer historisch nie dagewesenen Reizüberflutung und Optionenvielfalt ausgesetzt. Zugleich konnte die Evolution nicht schnell genug nachrüsten, das heißt, der heutige Mensch hat keine signifikant höhere Hirnleistung als ein Steinzeitmensch. Dies nicht einsehen zu wollen hat einen Preis, den wir noch gar nicht abschätzen können. Je mehr digitales Spielzeug, konsumtiven Komfort, Mobilität und Reizdröhnungen wir jungen Menschen angedeihen lassen, desto mehr verkümmern bestimmte Fähigkeiten. Zudem entbrennt eine Verwendungskonkurrenz um knappe, niemals vermehrbare Aufmerksamkeit. Konkret: Was ich an Aufmerksamkeit dem Smartphone widme, steht nicht mehr für das Lernen schulischer Inhalte zur Verfügung. Das Resultat ist eine Mischung aus Verblödung und langsamer Senkung der Ansprüche unseres Bildungssystems, das ja darauf beruht, immer mehr Menschen zu Akademikern werden zu lassen. Das wiederum senkt die Leistungsfähigkeit der späteren Arbeitnehmer und somit die Produktivität der Wirtschaft.
Sollten wir nicht froh sein, dass wir in materiellem Wohlstand leben und diese Konsummöglichkeiten haben? Viele Menschen in weniger wohlhabenden Ländern beneiden uns darum.
Gegenfrage: Wer gibt uns das Recht auf diesen Wohlstand, von dem jeder weiß, dass er ökologisch verantwortungslos ist und nicht das Resultat eigener physischer Arbeit sein kann?
Werden die Menschen so weiterkonsumieren, oder erwarten Sie einen gesellschaftlichen Wandel hin zum Konsumverzicht?
Beides findet parallel statt. Es gibt gleichzeitig rücksichtslose Egomanen und postwachstumstauglich lebende Zeitgenossen. Letztere nehmen eine sehr wahrscheinliche Zukunft vorweg. An diesen Pionieren können sich andere orientieren, wenn der Laden, so wie in Griechenland, zusammenkracht.
Was ist für Sie Lebensqualität?
Gefühltes Wohlergehen bei gleichzeitigem Bewusstsein, nicht über die materiellen Verhältnisse zu leben.
Niko Paech ist Volkswirt und hat seit 2010 eine Gastprofessur am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt („PUM“) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Schwerpunktmäßig forscht er in den Bereichen Umweltökologie, Ökologische Ökonomie und Nachhaltigkeitsforschung. Sozusagen: Alles im grünen Bereich bei ihm.
Войдите на сайт
через:
Mail.ru
Google
Яндекс
Фейсбук
ВКонтакте
Одноклассники
Niko Paech auf einer Veranstaltung zur Postwachstumsökonomie (2011)
Niko Paech (* 9. Dezember 1960 in Schüttorf[1]) ist ein deutscher Volkswirt. Er lehrt und forscht an der Universität Siegen als außerplanmäßiger Professor im Bereich der Pluralen Ökonomik.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich der Umweltökonomie, der Ökologischen Ökonomie und der Nachhaltigkeitsforschung. Paech hat in Deutschland den Begriff der „Postwachstumsökonomie“ geprägt und gilt als vehementer Verfechter der Wachstumskritik.
Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Paech erlangte 1987 ein Diplom in Volkswirtschaftslehre an der Universität Osnabrück. Anschließend arbeitete er dort bis 1997 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Außenwirtschaft bei Michael Braulke. 1993 wurde er zum Thema Die Wirkung potentieller Konkurrenz auf das Preissetzungsverhalten etablierter Firmen bei Abwesenheit strategischer Asymmetrien im Bereich Contestable Markets promoviert.[2] Parallel arbeitete er als Unternehmensberater im Bereich ökologische Lebensmittel und kandidierte bei der Wahl 1990 für den niedersächsischen Landtag.[3]
2005 war Paech einer der Gründer und erster Vorstandssprecher des wissenschaftlichen Zentrums CENTOS (Oldenburg Center for Sustainability Economics and Management) und leitet seit 2006 das Forschungsprojekt GEKKO.[1] Von 2010 bis 2014 war er zunächst gemeinsam mit Gerhard Oesten, später mit Oliver Richters[4] Vorsitzender der Vereinigung für Ökologische Ökonomie (VÖÖ).[5] Paech war außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirates von attac-Deutschland.[6] Paech ist außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Vereins Naturschutzinitiative e.V., welcher Klimaschutz als Ersatzreligion sieht.[7][8]
Paechs ehemalige Wirkungsstätte im Institut für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik der Universität Oldenburg
Im Jahre 2006 wurde ihm für seine im Vorjahr publizierte Habilitationsschrift zum Thema Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum – Eine unternehmensbezogene Transformationstheorie der Kapp-Forschungspreis für Ökologische Ökonomie verliehen.[9] Von 2008 bis 2018 organisierte er gemeinsam mit Werner Onken die „Ringvorlesung zur Postwachstumsökonomie“ in Oldenburg, in der Vortragende aus Wissenschaft und Gesellschaft über die Bedingungen und Möglichkeiten einer Postwachstumsökonomie diskutieren.[10][11][12] 2012 veröffentlichte er die Streitschrift „Befreiung vom Überfluss“.[13] 2014 wurde er mit dem Zeit-Wissen-Preis Mut zur Nachhaltigkeit ausgezeichnet.[14]
Von 2008 bis 2016 vertrat Paech den in dieser Zeit unbesetzten Lehrstuhl für Produktion und Umwelt („PUM“) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.[15] Im Jahr 2010 ist er an der Universität Oldenburg zum außerplanmäßigen Professor ernannt worden.[16] Seit 2016 lehrt er im Rahmen des neuen Masterstudiengangs Plurale Ökonomik an der Universität Siegen.[17] 2018 wurde er dort ebenfalls zum außerplanmäßigen Professor ernannt.
Postwachstumsökonomie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.
Der von Paech in Deutschland ab 2006 in die Diskussion gebrachte Begriff der Postwachstumsökonomie[18][19] bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das zur Versorgung des menschlichen Bedarfs nicht auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Paech zufolge bedingen Wachstumsgrenzen wie Ressourcenknappheit, psychische Grenzen („Überforderungssyndrom“), Krisenrisiken des Finanz-, Kapital- und Geldsystems sowie ökologische Grenzen (Planetary Boundaries) das Ende des Wachstums. Paech grenzt sich bewusst von Begriffen der Nachhaltigkeitsdebatte wie „grünem“ oder „nachhaltigem“ Wachstum ab, bezeichnet das Konzept von grünem Wachstum gar als Utopie,[20] Wunder[21] oder Mythos[22]. Er sieht sich aber auch ausdrücklich nicht als Linker und bezeichnet sich als eher konservativ sowie dem Anarchismus nahestehend.[23] Die Notwendigkeit für eine stationäre Wirtschaft ergibt sich für ihn aus der nach seiner Auffassung gescheiterten Entkopplung der Umweltschäden und des Rohstoffverbrauchs von der Wertschöpfung und aus ökonomischen Grenzen wie dem globalen Ölfördermaximum.[24]
Begründung für die Notwendigkeit einer Postwachstumsökonomie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Paech vertritt die Ansicht, dass die modernen Gesellschaften ihren wachsenden materiellen Wohlstand durch Entgrenzungsmechanismen erlangt haben.[25]:10 Die konsumierten Güter seien mit lokalen und regionalen Ressourcen und den eigenen körperlichen Fähigkeiten gar nicht zu produzieren.[25]
Erst maschinelle, elektrifizierte, automatisierte oder digitalisierte Hilfsmittel würden die Befriedigung materieller Ansprüche ermöglichen; regional nicht vorhandene Ressourcen würden mit Hilfe globaler Wertschöpfungsketten andernorts beschafft. Die bei der Produktion auftretenden ökologischen Probleme würden so einerseits örtlich verlagert,[25]:49 zugleich jedoch die Kosten mittels Krediten in die Zukunft verschoben.[25]:57 Ständig neue Technologien würden das Problem verschärfen, da alte Maschinen entsorgt werden müssten – eine langfristigere Nutzung sei aber oftmals insgesamt nachhaltiger als der frühzeitige Ersatz.[25]:97 Gesellschaften, die von dieser „Fremdversorgung“ besonders abhängig seien, weil die Menschen sich ausschließlich mittels Geld versorgen, seien besonders anfällig: Sie stünden unter Wachstumszwang, weil „moderne, zumal industriell arbeitsteilige Versorgungssysteme ohne Wachstum ökonomisch und sozial nicht zu stabilisieren sind.“[26][25]:64–5
Neben den ökologischen Schäden betont Paech, dass die Menschen vom Konsum auch psychisch überfordert seien. Er kritisiert insbesondere das Streben nach Wachstum, den „Expansionsrausch“ und die „verantwortungslose Selbstverwirklichung durch materiellen Konsum“.[25] Er bezeichnet dies als „Konsumverstopfung“[27] oder „Konsum-Burnout“, die „radikale Reduktion von Ansprüchen, welche der materiellen Selbstverwirklichung dienen, sei kein Mangel, sondern ein Gewinn.“[28] Mit Verweis auf Ansätze der Lebenszufriedenheitsforschung argumentiert Paech, dass subjektives Wohlbefinden an Faktoren geknüpft ist wie zwischenmenschliche Beziehungen, Gesundheit, Anerkennung sowie eine intakt empfundene Umwelt. Diese Faktoren benötigen jedoch mehr Zeit und nicht mehr Geld. Das Wohlbefinden sei demnach nicht durch mehr Konsum oder Einkommen zu steigern.[25]:126
Niko Paechs Konzept[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Kerngedanke der Postwachstumsökonomie besteht in der Aufhebung struktureller sowie kultureller Wachstumstreiber und Wachstumszwänge.[29] Dafür vertraut Paech auf fünf Prinzipien: institutionelle Innovationen, stoffliche Nullsummenspiele,[30] Regionalökonomie, Subsistenz (von lateinisch subsistentia „Bestand“: „durch sich selbst, Selbständigkeit“: «sich selbst erhaltend») und Suffizienz (von lat. sufficere, dt. ausreichen: «möglichst geringer Ressourcenverbrauch»), „die letztlich in einer höheren individuellen Lebensqualität und mehr Gemeinwohl resultieren.“ Mittels Genügsamkeit bzw. Suffizienz würde der Anspruch verringert, Ressourcen zu verbrauchen. Dies schließt für Paech einen weitgehenden Rückbau von Autobahnen und Flughäfen ein.
Für die Produktion soll die Distanz zwischen Verbrauch und Herstellung verringert werden. Statt globaler Wertschöpfungsketten empfiehlt er einfache Technologien, welche die Produktivität menschlicher Arbeit erhöhen, ohne diese vollständig zu ersetzen, wie z. B. mechanische Nähmaschinen und Angelruten.[25]:59[31] Durch eine Erhöhung der Regional-, Lokal- oder Selbstversorgung würden die strukturellen Wachstumstreiber der „Fremdversorgung“ verringert. Die Kombination aus Gemeinschaftsnutzung sowie Nutzungsdauerverlängerung von Gütern und Eigenproduktion könne dazu beitragen, die Industrieproduktion zu halbieren und die Notwendigkeit monetär entlohnter Erwerbsarbeit zu senken, ohne dass der materielle Wohlstand halbiert werden müsste. Denn: „Wenn Konsumobjekte doppelt so lange halten und/oder doppelt so intensiv genutzt werden, reicht die Hälfte an industrieller Produktion, um dasselbe Quantum an Konsumfunktionen oder ‘Services’ zu extrahieren.“[25]:123 Aus Konsumenten werden dabei sogenannte Prosumenten, weil sie die hergestellten Güter verbessern und reparieren können.[25]
Für die Individuen schlägt Paech vor, eine größere Zufriedenheit und eine geringere Abhängigkeit von globalen Wertschöpfungsketten anzustreben. Es existierten allerdings keine per se nachhaltigen Produkte und Technologien, sondern nur nachhaltige Lebensstile.[32][33] Diese könnten durch Reduzierung der Arbeitszeit auf eine 20-Stunden-Woche und mehr Zeit für den Selbstanbau von Obst und Gemüse und für die Instandsetzung und das Teilen von Gegenständen erreicht werden.[34] Dadurch hätten die Menschen mehr Freizeit und ein entschleunigtes Leben. Durch die Orientierung am menschlichen Maß und der Rückkehr zur Sesshaftigkeit würden die kulturellen Wachstumstreiber verringert.[25]:103–12 Subsistenz beziehungsweise Selbstversorgung als zweites Prinzip wird durch eigene Produktion, Gemeinschaftsnutzung (Sharing Economy), Reparatur und gemeinnützige Arbeit erreicht. Er empfiehlt, effiziente, wandelbare und wiederverwertbare Produkte herzustellen. Er regt an, handwerkliche und manuelle Versorgungsleistungen für sich selbst und für das nahe soziale Umfeld unentgeltlich zu erbringen, um sich selbst vor zukünftigen Ressourcenknappheiten zu wappnen, die Umwelt zu schützen und Wachstumszwänge zu mildern. Er hält es für sinnvoll, wenn eine Avantgarde bereits einen entsprechenden Lebensstil pflegt und mit weniger Konsum gut auskommt, damit sie mit ihrem Erfahrungswissen und ihrem Vorbild dazu beiträgt, Frustrationen, Ängste und eventuelle Gewalt zu verringern.[35]
Das Fazit dieser Erneuerung wäre laut Paech zwar, dass der aktuelle materielle Wohlstand sich so nicht aufrechterhalten ließe, allerdings verbessere sich die Resilienz, also die ökonomische Stabilität der Versorgung.[25]:11 Institutionell schlägt Paech Regionalwährungen mit Umlaufsicherung sowie Veränderungen am Finanzmarkt vor,[19] wobei er sich insbesondere auf Hans Christoph Binswanger beruft.[29] Im Umgang mit Boden fordert er eine Begrenzung der Flächenversiegelung.[19] und für Treibhausgas-Emissionen individuelle Obergrenzen.[19][36]
Im Hinblick auf die Bewältigung des Klimawandels setzt Niko Paech weniger auf den Einsatz erneuerbarer Energien als vor allem auf den Ausstieg aus der Konsumorientierung.[37]
Rezeption[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sein Buch Befreiung vom Überfluss[25] wurde von Fred Luks in der ZEIT rezensiert. Er empfiehlt das Buch Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Lektüre, kritisiert aber, Paech nehme zu wenig Rücksicht auf die politische Dimension der Probleme und fokussiere sich zu stark auf individuelle Einschränkungen.[13] Annette Jensen in der tageszeitung erkennt in dem Buch eine scharfe und ironische Kritik des aktuellen Wachstumsmodells, vermisst jedoch eine überzeugende „Wegbeschreibung in eine wünschbare Zukunft“.[13] Ulrich Schachtschneider erkennt in der Zeitschrift für Sozialökonomie an, dass Paech „seine Skizze einer Postwachstumsökonomie konsequent aus seiner Ursachenanalyse“ herleitet und hält das Buch für einen „fulminanten Aufschlag“ und „Meilenstein“ im wachstumskritischen Diskurs, vermisst aber ebenfalls eine tiefere Diskussion der politischen Rahmenbedingungen.[38] Martin Leschke sieht Paechs Ansatz aus der Perspektive der konstitutionellen Ökonomie als radikalen Gegenentwurf zur Marktwirtschaft und meint, dass Paech die Möglichkeiten unterschätze, mittels neuer Ideen weiteres Wachstums zu erzeugen.[36] Paech wiederum hält derartige Konzepte von grünem oder qualitativem Wachstum für unrealistisch.[20][21]
Sonja Ernst im Deutschlandfunk hat zwar einerseits Zweifel, ob die Postwachstumsökonomie realistisch ist, erkennt aber an, dass das Buch „mit seinen konsequenten Forderungen mehr Anregungen als manche Weiter-So-Literatur“ enthalte.[39]
Paech gilt laut dem Sozialforscher Matthias Schmelzer als einer der wichtigen Vertreter der an individueller Suffizienz orientierten Strömung der wachstumskritischen Bewegung.[40] Im britischen Guardian wurde er 2012 in einem Artikel zur deutschen Postwachstumsbewegung als „one of the more high-profile members of this movement […] who recently published a controversial new book called Liberation from Affluence […]“[41] bezeichnet.
Laut der Wochenzeitung Die Zeit ist Paech „für viele klassische Ökonomen“ hingegen „ein Spinner. Einer, der sich mit seiner Radikalität in den Medien Gehör verschafft hat, dessen Vorstellungen sie aber für unrealistisch halten und dessen Methoden wissenschaftlichen Kriterien nicht genügen“.[42] Auch laut der NZZ und dem DUZ Magazin ist der Begriff „Spinner“ eine verbreitete Bezeichnung für Paech.[43][44] Laut dem Journalisten Stefan Laurin, Herausgeber des Blogs Ruhrbarone, ist die „Postwachstumsökonomie, vor allem in der Paechsen Ausprägung, eine menschenverachtende, gegen alle Ideen der Aufklärung stehende Ideologie, entstanden in jenem Sumpf, in dem völkisches- und ökologisches Denken eine grün-braune Brühe bilden“.[45][46] Für öffentliche Kritik sorgte u. a. der Vorschlag von Paech, seine Nachbarn für seiner Meinung nach umweltschädliches Verhalten wie eine Flugreise zur Rede zu stellen. Laut Hubertus Knabe, ehemaliger Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, erinnert ihn diese Forderung „an totalitäre Staaten“, „in denen man dazu angehalten wurde, gegen seine Mitbürger zu agitieren“.[47][48][49]
Schriften (Auswahl)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum. Eine unternehmensbezogene Transformationstheorie. Metropolis, Marburg 2005, ISBN 978-3-89518-523-6.
- Vom grünen Wachstum zur Postwachstumsökonomie. Warum weiteres wirtschaftliches Wachstum keine zukunftsfähige Option ist. In: Boris Woynowski et al. (Hrsg.): Wirtschaft ohne Wachstum?! Notwendigkeit und Ansätze einer Wachstumswende. 2012, ISSN 1431-8261
- Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. oekom, München 2012, ISBN 978-3-86581-181-3.
- Suffizienz und Subsistenz: Therapievorschläge zur Überwindung der Wachstumsdiktatur. In: Hartmut Rosa et al. (Hrsg.): Zeitwohlstand: Wie wir anders arbeiten, nachhaltig wirtschaften und besser leben. oekom, München 2013, S. 40–49, ISBN 978-3-86581-476-0.
- Mythos „Energiewende“. Der geplatzte Traum vom rückstandslosen, grünen Wachstum. In: Georg Etscheit (Hrsg.): Geopferte Landschaften. Wie die Energiewende unsere Umwelt zerstört. Heyne, München 2016, ISBN 978-3-453-20127-9.
- Zusammen mit Erhard Eppler: Was Sie da vorhaben, wäre ja eine Revolution… oekom, München 2016, ISBN 978-3-86581-835-5.
- Zusammen mit Manfred Folkers: All you need is less. Eine Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sicht. oekom, München 2020, ISBN 978-3-96238-058-8.
- Zusammen mit Nicolas Schoof und Rainer Luick: Respekt für das Insekt? Analyse des Aktionsprogramms Insektenschutz der deutschen Bundesregierung unter besonderer Beachtung transformativer Zugänge. Natur und Landschaft 7(95):316-324. DOI:10.17433/7.2020.50153847.316-324
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Literatur von und über Niko Paech im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- www.postwachstumsoekonomie.de – Website von Niko Paech mit Lebenslauf
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ a b Niko Paech: Lebenslauf. (PDF; 74 kB) Universität Oldenburg, archiviert vom Original am 3. März 2013 (Ausführlicher Lebenslauf auf der Internetseite der Universität Oldenburg (Memento des Originals vom 13. März 2013)).
- ↑ Niko Paech: Die Wirkung potentieller Konkurrenz auf das Preissetzungsverhalten etablierter Firmen bei Abwesenheit strategischer Asymmetrien. Duncker & Humblot, Berlin 1993.
- ↑ Max Zeising: Weniger arbeiten, weniger konsumieren (neues deutschland). Abgerufen am 30. Dezember 2020.
- ↑ Internetauftritt von Oliver Richters, abgerufen am 11. Mai 2020
- ↑ Vorstand der VÖÖ
- ↑ Wissenschaftlicher Beirat von attac — Aktuelles. Abgerufen am 19. Oktober 2021.
- ↑ 2021-10-22 Ernährung, Ackerbau und Landwirtschaft in der Postwachstumsökonomie. Archiviert vom Original am 23. Oktober 2021; abgerufen am 16. Oktober 2021.
- ↑ GEO Magazin August 2019 — «GUT FÜR`S KLIMA- SCHLECHT FÜR DIE NATUR?» Abgerufen am 16. Oktober 2021.
- ↑ Kapp-Forschungspreis — Preisträger 2006, abgerufen am 18. Oktober 2011
- ↑ Vortragsreihe zur Postwachstumsökonomie. Abgerufen am 29. August 2018 (deutsch).
- ↑ Niko Paech: Postwachstumsökonomie. Gabler Wirtschaftslexikon, abgerufen am 6. November 2018.
- ↑ Oliver Richters: Analyse: Konfliktlinien und politische Ziele im wachstumskritischen Diskurs. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen. Band 31, Nr. 4, 2018, S. 80–84, doi:10.1515/fjsb-2018-0085.
- ↑ a b c Niko Paech: Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, Perlentaucher, abgerufen am 7. November 2018.
- ↑ Niko Paech mit dem ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit ausgezeichnet, Pressemitteilung der Universität Oldenburg, 28. Februar 2014.
- ↑ Felix Rohrbeck: Was bewegt Niko Paech? Der Verstoßene. Die Zeit, 23. März 2017.
- ↑ Profil auf der Seite der Universität, abgerufen am 5. November 2016.
- ↑ apl. Prof. Dr. Niko Paech auf der Seite des Studiengangs Plurale Ökonomik, abgerufen am 3. September 2019.
- ↑ Philipp Krohn: Schrumpfen von unten, Frankfurter Allgemeine, 26. Dezember 2013.
- ↑ a b c d Niko Paech: Stichwort: Postwachstumsökonomie, Gabler Wirtschaftslexikon, Springer Gabler Verlag (Hrsg.).
- ↑ a b Niko Paech: Wachstum „light“? Qualitatives Wachstum ist eine Utopie. In: Wissenschaft & Umwelt. Interdisziplinär 13|2009, S. 85–86.
- ↑ a b „Grünes“ Wachstum wäre ein Wunder. In: Zeit.de, 21. Juni 2012.
- ↑ Niko Paech: Das Elend der Konsumwirtschaft: Von Rio+20 zur Postwachstumsgesellschaft, Blätter für deutsche und internationale Politik, Juni 2012.
- ↑ Johann Thun: „Aussteigen, aufbrechen“. Wachstumskritiker Niko Paech über die Grenzen von Erde, Staat und linker Gesinnung. In: Der Rabe Ralf. Dezember 2022, abgerufen am 29. Dezember 2022.
- ↑ Niko Paech: Grundzüge einer Postwachstumsökonomie. Abgerufen am 18. Oktober 2011.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n Niko Paech: Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, 8. Aufl., oekom verlag, München 2015, ISBN 978-3-86581-181-3.
- ↑ Niko Paech: Jenseits der Wachstumsspirale, DFG-Kolleg Postwachstum Jena, 30./31. Mai 2013, S. 6.
- ↑ Markus Brauck und Dietmar Hawranek: Überdruss am Überfluss. Der Spiegel 14/2014, 31. März 2014.
- ↑ Seraina Kobler: Soviel du «brauchst», Neue Zürcher Zeitung, 15. November 2014.
- ↑ a b Niko Paech. «Woher kommt der Wachstumszwang?.» GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society 16.4 (2007): 299–300. doi:10.14512/gaia.16.4.13
- ↑ Niko Paech: Wachstumsneutralität durch stoffliche Nullsummenspiele. In: Ökologisches Wirtschaften. Nr. 3, 2006, S. 30–33.
- ↑ Niko Paech: Befreiung vom Überfluss – Grundlagen einer Wirtschaft ohne Wachstum. In: Fromm Forum 20, 2016, S. 70–76, ISSN 1437-0956
- ↑ Niko Paech: Wachstumsdämmerung, Artikel in Oya 7/2011 (Onlineversion).
- ↑ Niko Paech: Die Legende vom nachhaltigen Wachstum. In: Le Monde diplomatique. Abgerufen am 27. Juli 2015.
- ↑ Jakob Pallinger: Edition Zukunft: Umweltökonom: «Wir sind zu Konsumdeppen geworden». Durch unseren ständigen Fokus auf Wachstum und Konsum steuern wir auf eine ökologische Katastrophe zu, sagt der Umweltökonom Niko Paech. Wir müssen unsere Ansprüche verändern. In: www.derstandard.de. Der Standard, 1. April 2022, abgerufen am 4. April 2022 (Interview, MP3-Podcast (41 Min.)).
- ↑ Ökonomie und Ökologie: ‘Grünes Wachstum’ gibt es nicht. sueddeutsche.de, 17. Januar 2014, abgerufen am 18. Januar 2014.
- ↑ a b Leschke, Martin (2015): Alternativen zur Marktwirtschaft: Ein kritischer Blick auf die Ansätze von Niko Paech und Christian Felber aus Sicht der konstitutionellen Ökonomik, Beiträge zur Jahrestagung des Ausschusses für Wirtschaftssysteme und Institutionenökonomik im Verein für Socialpolitik: „Marktwirtschaft im Lichte möglicher Alternativen“, 27.–29. September 2015, Bayreuth, Verein für Socialpolitik, Ausschuss für Wirtschaftssysteme und Institutionenökonomik, Münster.
- ↑ In: Was Sie da vorhaben, wäre ja eine Revolution…, oekom, München 2016 (zitiert nach der Kindle-Ausgabe, S. 106, Pos. 983)
- ↑ Ulrich Schachtschneider: Rezension zu Befreiung vom Überfluss, Zeitschrift für Sozialökonomie 174–175/2012, S. 80–83.
- ↑ Sonja Ernst: Abschied vom Wachstumscredo, Deutschlandfunk, Andruck – Das Magazin für Politische Literatur, 6. August 2012.
- ↑ Matthias Schmelzer (2015): Spielarten der Wachstumskritik. Degrowth, Klimagerechtigkeit, Subsistenz – eine Einführung in die Begriffe und Ansätze der Postwachstumsbewegung. In: Le Monde diplomatique, Kolleg Postwachstumsgesellschaften. Atlas der Globalisierung. Weniger wird mehr. Berlin: Le Monde diplomatique/taz Verlags- und Vertriebs GmbH, S. 116–121.
- ↑ Sherelle Jacobs: Germany’s ‘post-growth’ movement, The Guardian, 19. September 2012.
- ↑ Die Zeit: Was bewegt Niko Paech?, vom 9. März 2017
- ↑ NZZ: «Dann geht in Gottes Namen unter»: Der Ökonom Niko Paech hat radikale Ansichten darüber, wie die Welt zu retten ist – aber er will niemanden zu seinem Glück zwingen, vom 4. November 2019
- ↑ DUZ Magazin: Auf Wachstum verzichten, um zu überleben, vom 16. November 2018
- ↑ Ruhrbarone: Niko-Paech: Wanderprediger mit Thesen aus dem grün-braunen Sumpf, vom 16. Januar 2017
- ↑ Salonkolumnisten: Wirtschaftstheorie aus dem braun-grünen Sumpf, vom 13. Januar 2017
- ↑ Epoch Times: Professor will Öko-Stasi – Bürger sollen Nachbarn fragen: „Wer gibt dir das Recht, einen SUV zu fahren?“, vom 24. Juli 2019
- ↑ Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag: Klima-Verhör am Gartenzaun: Nachbarn sollen sich für Urlaub und SUV kritisieren, vom 24. Juli 2019
- ↑ NZZ: «Dann geht in Gottes Namen unter»: Der Ökonom Niko Paech hat radikale Ansichten darüber, wie die Welt zu retten ist – aber er will niemanden zu seinem Glück zwingen, vom 4. November 2019
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Paech, Niko |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Volkswirtschaftler |
| GEBURTSDATUM | 9. Dezember 1960 |
| GEBURTSORT | Schüttorf |